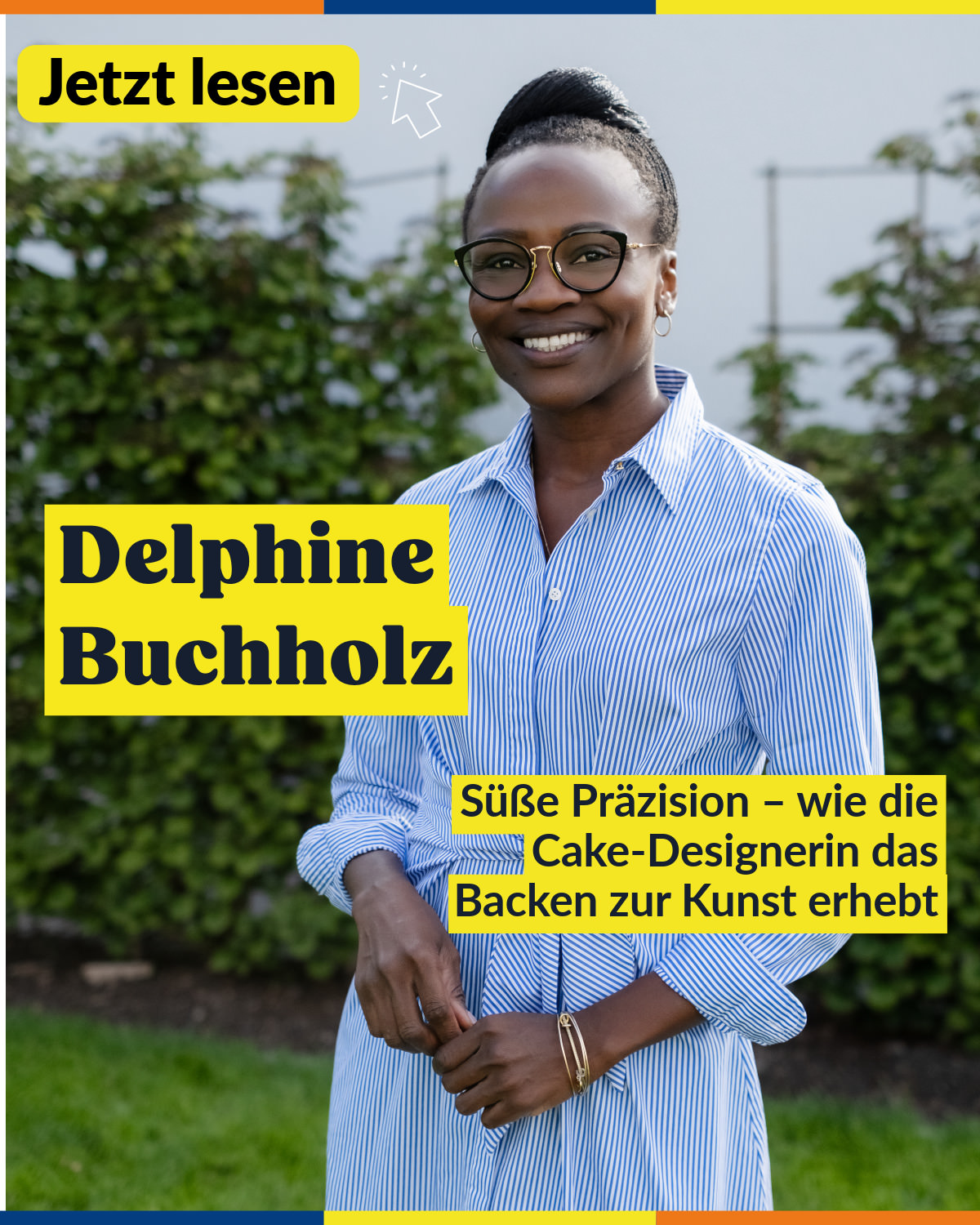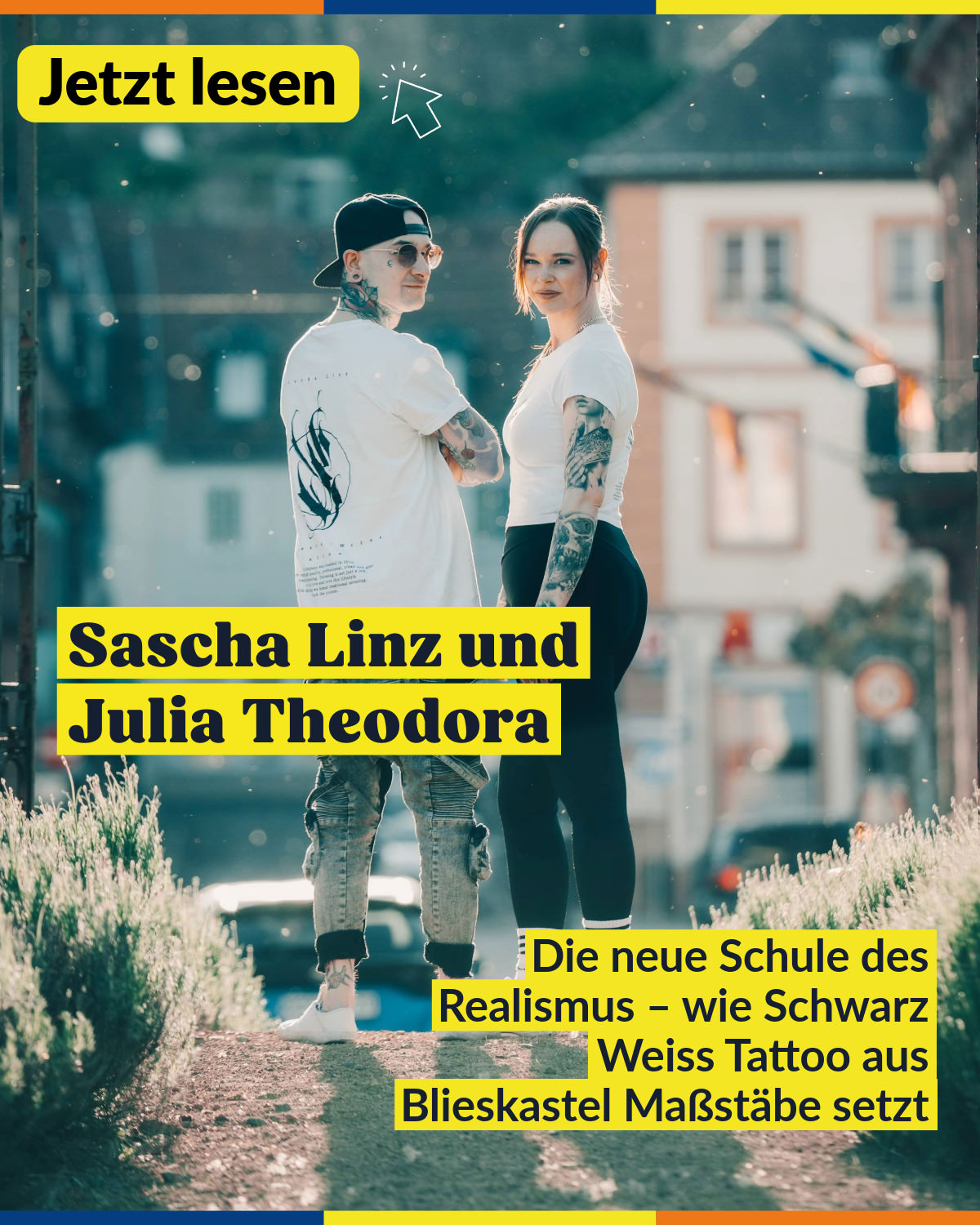Erhalten Sie das neue Jetzt. Magazin im bequemen Vorteilsabo für nur 31,60 € 4 mal im Jahr direkt nach Hause. (inkl. Versand)
Oder nutzen Sie unser Jetzt. Business-Abo und erhalten Sie das Jetzt. Magazin für Ihre Kunden und Mitarbeiter. Perfekt für Wartebereiche, Lounges & Meetings.