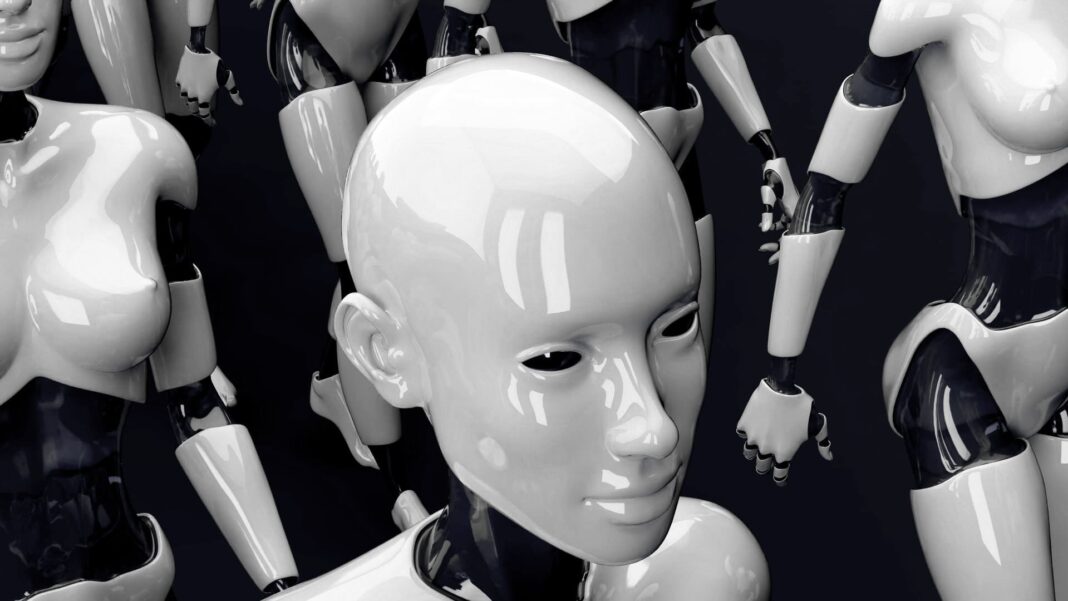Von Daniel von Hofen
Was macht eine Maschine eigentlich „intelligent“? Diese Frage beschäftigt nicht nur Fachleute, sondern auch immer mehr Menschen, die im Alltag mit Systemen wie ChatGPT, Alexa oder automatisierten Service-Hotlines in Berührung kommen. Doch hinter der Faszination für sprechende Roboter und textgenerierende Programme steckt ein Forschungsfeld, das sich rasant entwickelt – und viele Menschen verunsichert. Zeit also, genauer hinzusehen. Einer, der sich damit auskennt, ist Prof. Adrian Müller von der Hochschule Kaiserslautern. Gemeinsam mit seinem Team forscht er zu künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik – und weiß aus erster Hand, wie rasant der Fortschritt ist, aber auch, wie oft dabei falsche Erwartungen und unbegründete Ängste aufeinandertreffen.
Die einfachste Erklärung, sagt Müller, sei oft die beste: „Künstliche Intelligenz soll helfen – wie ein Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzer. Nur eben auf kognitiver Ebene.“ Das Ziel sei nicht, den Menschen zu ersetzen, sondern ihm Routinen abzunehmen und Fehler zu vermeiden. Zwar gebe es verschiedene Definitionen – von der Nachbildung menschlichen Denkens bis zur Turing-Test-basierten Illusion von Intelligenz –, doch alle eint das Ziel, komplexe Prozesse maschinell zu erfassen und umzusetzen. Der Informatikprofessor plädiert für eine pragmatische Sichtweise: „KI kann viel, aber sie ersetzt keine Kreativität.“ Trotzdem kursieren nach wie vor zahlreiche Mythen. KI werde den Menschen überflüssig machen, heißt es da, oder sie werde irgendwann selbständig die Kontrolle übernehmen. Aus Sicht des Wissenschaftlers sind das Märchen – gefährlich allenfalls, wenn sie verhindern, dass man sich ernsthaft mit den echten Herausforderungen auseinandersetzt.
Die Reise der künstlichen Intelligenz begann schon viel früher, als viele denken. Bereits in den 1960er Jahren entwickelte Joseph Weizenbaum den ersten Chatbot „Eliza“, der mit einfachen Mustern Gespräche simulierte – damals in der Programmiersprache LISP. Müller erinnert sich an die Faszination: „Seine Sekretärin hat sich mit dem Programm über ihre Eheprobleme unterhalten. Das war ein Aha-Erlebnis.“ Danach folgten die regelbasierten Expertensysteme der 1980er, die zum Beispiel bei medizinischen Diagnosen halfen. Doch bald darauf flaute die Begeisterung wieder ab – der sogenannte „KI-Winter“ der 1990er Jahre war vor allem von enttäuschten Erwartungen geprägt.
Und heute? Heute sind es die sogenannten „Large Language Models“ – wie ChatGPT –, die weltweit für Aufsehen sorgen. Sie erzeugen Texte, die täuschend menschlich wirken. Doch sie funktionieren ganz anders als der Mensch. „Die Systeme bilden keine Gedanken ab, sondern errechnen aus gewaltigen Datenmengen die wahrscheinlichste Wortfolge“, erklärt Müller. Er sieht hier eine neue Dimension: „Die Multimodalität dieser Modelle, also ihre Fähigkeit, Text, Bilder, Ton und sogar Videos zu verarbeiten, ist ein echter Gamechanger.“ Diese Multimodalität sei ein riesiger Fortschritt – und eröffne Anwendungen, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar schienen.